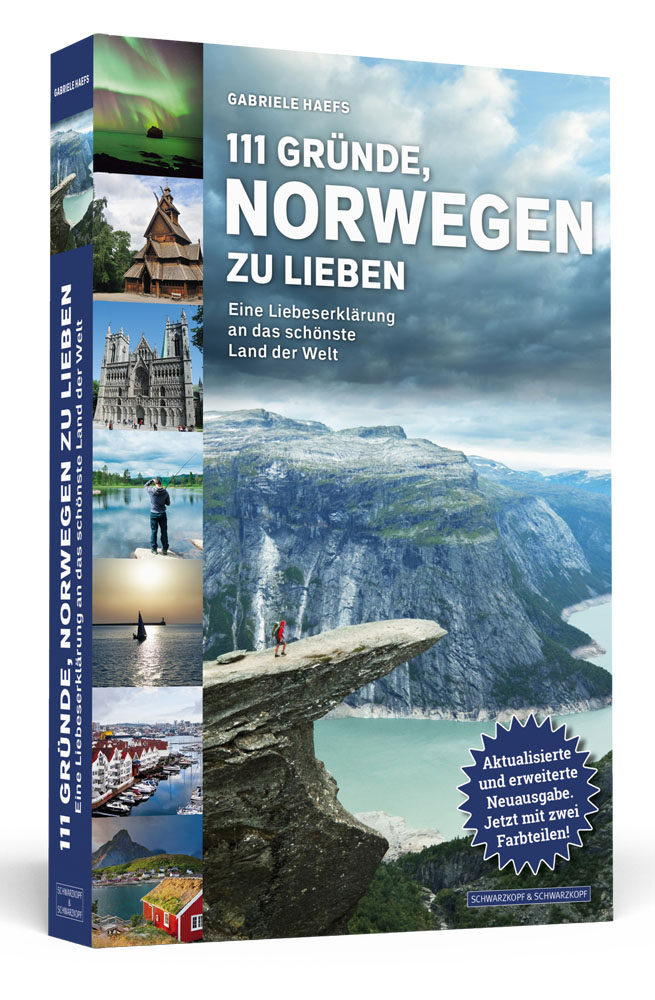Der Lutefisk ist eine hierzulande noch ziemlich unbekannte norwegische Spezialität. Ihn kennen oft nicht mal hartgesottene Norwegenreisende. Das liegt sicher daran, dass er nicht zu den üblichen Reisezeiten aufgetischt wird, nicht zur Skisaison und auch nicht in der sommerlichen Bergwanderungszeit. Und auch aus den goldenen Jahren um 1900, als so ungefähr jedes norwegische Buch ins Deutsche übersetzt wurde und hier begeisterte Leser fand, ist keine vage Erinnerung an dieses Gericht im kollektiven Bewusstsein zurückgeblieben: Weder in Hamsuns Romanen noch in Ibsens Stücken wird Lutefisk verzehrt. Eigentlich war er auch in Norwegen so mehr oder weniger aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden, galt als hoffnungslos altmodisch, spießig und, schlimmer noch, kalorienreich!

Läutern
Doch dieses vernichtende Urteil konnte es dann doch nicht verhindern, dass der Lutefisk ein phänomenales Comeback hinlegte. Ohne Lutefisk ist eine norwegische Weihnachtszeit so undenkbar wie eine deutsche ohne Glühwein. Im Wort Lutefisk steckt etymologisch das Wort „läutern“, und in der Tat macht der arme Fisch einen Läuterungsprozess durch, dass man sich fragen kann, ob er auf dem Meeresgrund wohl wirklich so furchtbare Sünden begangen hat, dass er das verdient. Allerdings kann sich das mit der Läuterung auch auf die fischessenden Menschen bezogen haben. Nachweislich wurde er in Norwegen und Schweden bereits vor der Reformation verzehrt, als im katholischen Brauchtum im Advent, noch heute eben die Lutefisksaison, ebenso streng gefastet wurde wie in der Fastenzeit vor Ostern. Der Fisch, um den es hier geht, ist Kabeljau, in den Sommermonaten gefangen und gedörrt, bis er bleich und steif wie ein Brett ist, weshalb er dann Stockfisch genannt wird. Damit das mit dem Steifwerden und austrocknen richtig gut klappt und das Tier auch noch haltbar wird, wird er ungeheuer stark gesalzen, und wenn Hans Christian Andersen in seiner „Schneekönigin“ Briefe auf Stockfischen schreiben lässt, ist das nicht übertrieben. Weil die Fische oft zum Trocknen auf Felsen oder Klippen gelegt werden, werden sie auch Klippfisch genannt.
Abenteuer Fischessen
Das aber passiert dem stockstarren Tier: Es wird in Lauge eingelegt. Diese Lauge wird zumeist auf Basis von Birkenasche zusammengebraut, aber über die weiteren Zutaten schweigen die norwegischen Kochbücher. Die Lutefiskköche sowieso, die genauen Zutaten werden gehütet, als handelte es sich um uralten Sippengeheimnisse, seit Generationen vom siebten Sohn auf den siebten Sohn weitergegeben. Der Fisch liegt dann der Lauge, Tage und Wochen, und irgendwann ist er dann ausgelaugt, wird noch einmal in Wasser eingelegt und dann gekocht. Zu diesem Zeitpunkt ist er geleeartig, glibberig, fast durchsichtig und sieht eigentlich vor allem aus wie ein großer Gummibär, nur eben fischförmig. Und mit Gräten, aber weil die Gräten genau die Farbe des sie umgebenden Glibberfisches haben, fallen sie gar nicht weiter auf – oder erst beim Essen, und dass man sie nicht sehen kann, gibt dem Lutefischverzehr einen Hauch von Abenteuer. Das ist auch nötig, denn eigentlich schmeckt er nach nichts, höchstens ganz leicht fischig. Wenn man Glück hat.
Wichtig sind deshalb die Zutaten: Der Lutefisk wird mit gekochten Kartoffeln serviert, so weit ist alles klar, dazu gibt es Erbsenpüree, und schon gehen die Fehden los. Soll das Püree von gelben oder grünen Erbsen stammen? Dazu zerlassene Butter und krossgebratener Speck, so dass das Gericht dann eben doch nach etwas schmeckt. Bier und Aquavit sind unverzichtbare Zugaben, doch auch Ziegenkäse, Backpflaumen und Preiselbeeren wurden in abenteuerlustiger Runde schon gesichtet. Noch eine Frage: Darf man Senf dazu reichen? Es gibt keine eindeutigen Antworten, nur, wie gesagt, einander heftig bekämpfende Fraktionen.

Lutefiskgilden
Als so gegen Ende des 20. Jahrhunderts auch in Norwegen die Lust an experimentierender Küche verging (Sie wissen schon, solche Gerichte, wie Loriot sie als „sehr übersichtlich“ bezeichnet hat), begann der moderne Triumphzug des Lutefisk. Er war nie ganz weg, und in Restaurants in Oslo, wo „gutbürgerlich“ gekocht wurde, gab es ihn immer. Nun aber war er plötzlich allgegenwärtig und ist es noch. Im November geht es los. Die Restaurants bieten Lutefisk an, veranstalten Lutefiskabende, es gibt Lutefiskvereine und auch lockere Gruppen von Freunden und Kollegen, die sich zum rituellen Lutefiskverzehr treffen. Zum Lutefiskgenuss gehört auch, dass man pointenlose Witze erzählt und gar zu lange Tischreden hält (aber darüber tröstet dann der immer in Strömen fließende Aquavit hinweg). Weil es gar nicht genug Restaurants gibt und viele Norweger gleich in mehreren Lutefiskgilden sind (so nennen sie sich wirklich) und vielleicht zudem noch die Weihnachtsfeier im Betrieb mit einer Lutefiskrunde verbunden ist, geht es im Januar munter weiter mit der Lutefiskesserei. Das verstößt zwar gegen jegliche Tradition, aber was soll man machen?
Bis zur Wiederbelebung der Lutefisktraditionen war es oft schwer, Lutefisk aufzutreiben. Ich weiß nicht, wie oft ich Freunde gebeten habe, doch endlich mal dieses sagenumwitterte Gericht zuzubereiten. Immer sagten sie: „Ja, wenn du unbedingt willst“, aber am fraglichen Abend gab es dann Brathähnchen. Es war ihnen schlicht peinlich – oder vielleicht sollten sie ihren kostbaren Lutefisk für sich behalten?
Aber das gehört zum norwegischen Lutefiskmythos. Der Lutefisk, so wird dem Gast aus lutefisklosen Landen immer wieder versichert, sehe dermaßen widerlich aus, man könne ihn nur runterbringen, wenn man von Kind an daran gewöhnt sei. Das sagen sie und glauben es auch. Aber es stimmt nicht. Wie gesagt, der Lutefisk sieht aus wie ein großer Gummibär, und was könnte daran widerlich sein? Zumal er eben, wie gesagt, nach nichts schmeckt. Außer nach gebratenem Speck natürlich. Und manchmal nach Senf.
Das ist der eine norwegische Lutefiskmythos. Der zweite: Ja, es gibt auch in Schweden Lutefisk, aber dort heißt er eben nur Lutfisk. Das fehlende -e- gilt heimatstolzen Norwegern als unwiderlegbarer Beweis dafür, dass die schwedische Variante von minderer Qualität ist und weiter keine Erwähnung verdient.
Das Lutefiskkochen hat es übrigens in sich. Meine norwegische Lieblingsautorin Sigrid Boo beschreibt den Versuch einer ungeübten Köchin: „Als das Wasser anfing zu kochen, warf ich die Fischstücke hinein, dann ging ich auf den Balkon, um mich ein bisschen zu sonnen. Als ich wieder in die Küche kam – nach höchstens einer halben Stunde – war der Fisch einfach verschwunden. Weder im Topf noch sonst irgendwo auf dem Herd konnte ich auch nur eine Spur von ihm finden. Als ich dann mit einer Kelle in dem fahlen, trüben Wasser herumfischte, fand ich immerhin noch genug Fisch, um einen Fingerhut zu füllen. Ach, Mama, warum hast du mir nicht gesagt, dass Laugenfisch nicht lange kochen darf?“