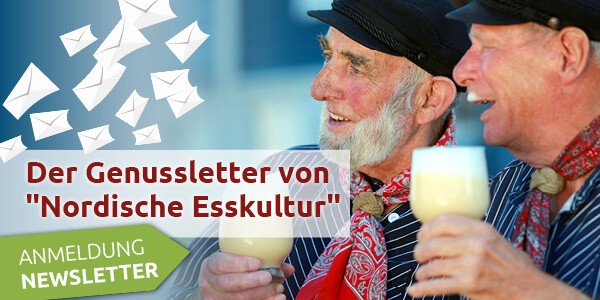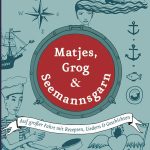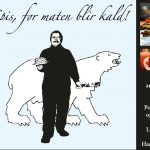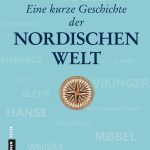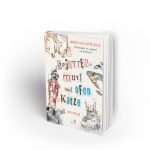Der Name ist Programm: Labskaus ist eine handfeste Angelegenheit, abgeleitet vom Seemannsenglischen „lobs“ für derber Kerl und „course“ für Mahlzeit. Über das norwegische lapskaus (gesalzener Kabeljau mit Kartoffeln) kam der Name in den norddeutschen Sprachgebrauch. Tatsächlich findet sich der nahrhafte Kartoffelbrei mit gepökeltem Fleisch überall da, wo es Häfen, Seemänner und die Hanse gab.

Maritimer Eintopf
Bis heute preisen Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein Labskaus als regionale Spezialität und touristische Attraktion, und auch die Stadt Liverpool rühmt sich ihres Liverpool Scouse, eines Eintopfs aus geschmortem Lamm– oder Hammelfleisch, der mit Möhren, Roter Bete und reichlich Kartoffeln in den örtlichen Pubs gereicht wird. In North Wales löffeln die Menschen gerne einen ähnlichen Eintopf, liebevoll Lobby genannt. In Norwegen, Schweden und Dänemark – wo der Skipperlabskovs natürlich als Smørrebrød gereicht wird – ist das Gericht in Abwandlungen bekannt, gerne auch als gemischter Wochenrückblick (Reste der Woche), über den ein gnädiges Deckmäntelchen aus Kartoffelpüree ausgebreitet wird. Rekordhalter im Labskaus-Essen sind aber wir Norddeutschen: Das größte Labskaus-Essen der Welt findet alljährlich in Wilhelmshaven statt, wo örtliche Gastronomen, das dortige Marinestützpunktkommando sowie die Köche des Katastrophenschutzes insgesamt gut10.000 Portionen Labskaus an einem Tag ausgaben.
Kartoffelstampf
Die Rezeptur, wohl erstmals 1701 erwähnt, startete bescheiden als Kartoffelstampf mit Pökelfleisch, Zwiebeln und Speck. Das klassische deutsche Labskaus der Segelschifffahrtszeit ist an Niederelbe, Nord- und Ostsee, sowie im nördlichen Niedersachsen zu Hause.
Hauptbestandteile sind gekochtes, gepökeltes Rindfleisch und gekochte Kartoffeln, die durch den Fleischwolf gedreht, mit Zwiebeln und Brühe in einer Pfanne cremig gerührt werden. Einst sorgte nur das Pökelfleisch für die charakteristische, rötliche Farbe, in neuzeitlichen Rezepten färbt auch die gekochte Rote Bete kräftig, die mit eingelegten Gurken, Heringen, Rollmöpsen oder Matjesfilet zusätzlich als Beilage gereicht wird. In Seemannskreisen setzte sich das Essen bald durch, weil gepökeltes Fleisch, Kartoffeln, eingelegtes Gemüse und gesalzene Heringe auf den Segelschiffen lange ungekühlt haltbar, einfach zuzubereiten und sehr nahrhaft waren. Und die Eier lieferte das an Bord mitgeführte Federvieh; nach Landgängen wurden auch schon mal frisch geräuberte Möweneier in die Pfanne gehauen.
Seemannsgarn
Nach einer Theorie ist das Labskaus entstanden, als es dem Smutje in seiner Kombüse bei schwerem Sturm nicht mehr möglich war, etwas Vernünftiges zu kochen. Also nahm er alles was er finden konnte und mixte es zu einem herzhaften Brei, der so gut in der Schüssel, auf dem Teller oder an den Löffeln klebte, dass man ihn auch noch bei hohem Wellengang verzehren konnte.
Ein etwas respektloser Matrosenspruch lautete: „Alles, was der Seemann im Laufe der letzten Woche verloren hat, findet sich im Labskaus wieder“.
Um den Fisch machten die Matrosen früher meist einen großen Bogen. Alles was nach Fisch schmeckte, war nach Monaten auf See verständlicher Weise höchst unbeliebt. Wehe dem Smutje, der den Fisch heimlich ins Püree häckselte. Auch heute und an Land gilt darum weiterhin: Fisch immer an den Tellerrand legen – Labskaus ist in erster Linie ein Fleischgericht.

Sollte man Labskaus modernisieren?
Eine neue Entwicklung im Zusammenhang mit Labskaus soll hier nicht unter die Schiffsplanken gekehrt werden. Eine Entwicklung, die die Gemüter der Norddeutschen erhitzt. Es stehen sich bei der Auseinandersetzung Traditionalisten und Erneuerer unversöhnlich gegenüber. Immer öfter versuchen ambitionierte Köche – sogar norddeutscher Abstammung – Labskaus – die Traditionalisten sagen zwanghaft – zu modernisieren, um das Seemannsessen auch für Feinschmecker und junge Menschen salonfähig zu machen. Da wird Kartoffelcreme mit japanischem Meerrettich geschärft oder getrüffeltes Kartoffelpüree mit Kalbstafelspitz angerichtet und mit Belugakaviar und Wachtelspiegelei vermählt. Von Traditionalisten hört man über solche Kreationen: Da würden selbst die derbsten Kerle zu weinen anfangen. Nun: Labskaus ist und bleibt Geschmackssache.
Labskaus-Gedicht eines unbekannten Seemanns
Was wäre am Ende, lieber Gott,
die ganze Seefahrt wert,
ständ nicht zuweilen so ein Pott
mit Labskaus auf dem Herd.
Und fragt man einen Seemann mal,
ob Labskaus oder Kuß,
ruft er: „Hier gibt es keine Wahl,
ich bin für beides, Schluß!
Das Gedicht mag nicht die lyrische Klasse von Goethe, Schiller und Heine haben. Aber es zeigt uns die Leidenschaft des Seemanns für Labskaus und Küsse. Warum sollte er wählen? Kuss und Labskaus sind für den unbekannten Seemann nicht voneinander zu trennen, verschmelzen, sind Eins. Labskaus und Erotik – ein noch zu wenig beachteter Aspekt der internationalen Labskaus-Forschung.